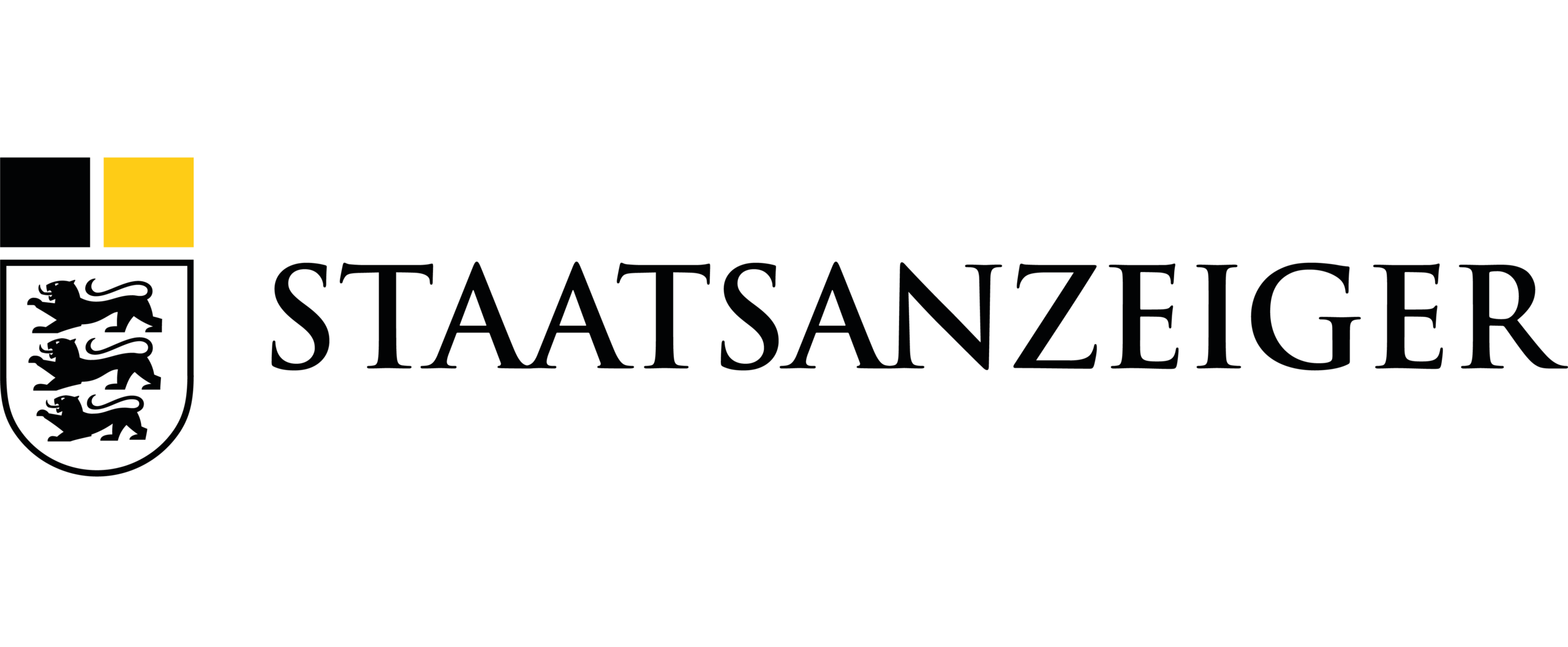Alexa, wann ist das Rathaus offen? – Wie KI den Bürgerservice aufmischt
Chatbots im Rathaus, KI im Bürgerservice – was nach Zukunft klingt, ist längst Alltag.
Immer mehr Kommunen setzen digitale Assistenten ein, um Anfragen schneller zu beantworten und Mitarbeitende zu entlasten. Doch wie lässt sich künstliche Intelligenz so einsetzen, dass sie hilft, ohne zu entmenschlichen? Wir sehen uns an, wie dies in der Verwaltung gelingen kann.
„Noch geöffnet?“ – drei Wörter, die nachts um 23:07 Uhr ins Suchfeld getippt werden. Und die Antwort kommt nicht mehr erst am nächsten Morgen vom Servicetelefon, sondern sofort: per Chatbot.
KI ist im Bürgerservice angekommen – von der Terminfrage bis zur Müllabfuhr, vom Führungszeugnis bis zu Gebühren. Die Frage ist längst nicht mehr, ob, sondern wie Verwaltungen KI einsetzen.
Die Herausforderung dabei ist jedoch, dass sie nicht nur den Service beschleunigt, sondern auch das Vertrauen stärkt
Was KI heute schon leistet – und wo die Grenzen liegen
KI kann heute schon erstaunlich viel – vor allem dort, wo es um Standardanfragen geht. Chatbots beantworten rund um die Uhr Fragen zu Öffnungszeiten, Formularen oder Zuständigkeiten und entlasten damit Schalter und Telefon. Durch Mehrsprachigkeit und barrierefreie Gestaltung werden zudem Hürden abgebaut und Informationen für mehr Menschen zugänglich.
Besonders spannend: Generative KI ist in der Lage, Inhalte aus städtischen Webseiten zu durchsuchen und daraus leicht verständliche Antworten zu formulieren – vorausgesetzt, die Datenlage ist solide. Doch wo Routine endet, stößt auch die Technik an ihre Grenzen: Komplexe Einzelfälle, Ermessensentscheidungen oder Beschwerden mit Konfliktpotenzial gehören weiterhin in menschliche Hände.
Drei aktuelle Praxisbeispiele
Drei Städte zeigen bereits, wie der Einsatz von KI im Verwaltungsalltag konkret aussehen kann – pragmatisch, bürgernah und mit klarer Vorstellung davon, was Technik leisten soll und was besser beim Menschen bleibt.
Ludwigsburg: L2B2 beantwortet Bürgerfragen rund um die Uhr
Der städtische Chatbot L2B2 (angelehnt an den pfeifenden Droiden R2D2 aus der Star-Wars-Trilogie) ist direkt auf ludwigsburg.de beim Bürgerbüro und Standesamt platziert. Er liefert standardisierte Auskünfte, entlastet Mitarbeitende und bietet Deutsch/Englisch als Sprachoption. Die Stadt betont ausdrücklich, dass es um einen „zusätzlichen Serviceweg“ geht – nicht um den Ersatz des Schalters.
Leonberg: „Leo“ nutzt generative KI
Der KI-Chatbot „Leo“ durchsucht die städtischen Seiten und weitere relevante Quellen, um individuelle Antworten zu generieren – kontextbezogen auf Verwaltung und Stadt. Ziel: häufige Fragen schneller klären und die Verwaltung spürbar entlasten. Offiziell ausgerollt Anfang März 2025.
Moers: Mehrsprachiger, barrierefreier digitaler Assistent
Seit 19. September 2025 ergänzt ein mehrsprachiger, barrierefreier KI-Chatbot den Bürgerservice auf moers.de – auch außerhalb der Öffnungszeiten. Medienberichte und die städtische Meldung unterstreichen den Ansatz „Rund-um-die-Uhr“ für Verwaltungsinfos und Veranstaltungen.
Der Spagat zwischen Effizienz und Empathie
Effizienz ist schnell erreicht: Prozesse automatisieren, Antworten standardisieren, Wartezeiten verkürzen. Doch in der öffentlichen Verwaltung geht es um mehr als Geschwindigkeit – es geht um Vertrauen. Kommunen und Behörden sind für Bürger:innen zentrale, oft sogar die wichtigsten Ansprechpartner im Alltag. Wenn sie KI einsetzen, muss diese daher nicht nur korrekt, sondern auch verlässlich und respektvoll kommunizieren.
Empathie ist dabei der entscheidende Faktor. Wer Bürger:innen ernst nimmt, gestaltet Chatbots so, dass sie verständlich, freundlich und transparent agieren – und erkennt rechtzeitig, wann es besser ist, an einen Menschen zu übergeben. Nur so bleibt die digitale Unterstützung das, was sie sein soll: ein zusätzlicher Service, kein Ersatz für Nähe und Dialog.
Damit das gelingt, braucht es klare Spielregeln – und ein paar zentrale Prinzipien, die jede Verwaltung beim KI-Einsatz beachten sollte.
Best Practice in fünf Punkten
- Use Cases eng definieren: Was beantwortet der Bot sicher (z. B. Fristen, Dokumente)? Was geht direkt an den Service?
- Klare Übergabewege: „Möchten Sie mit uns telefonieren/chatten? Hier ist die Nummer/der Livechat.“
- Transparenz by Design: Kennzeichnen, dass es ein Bot ist; Datenschutz kurz und klar erklären; Quellen nennen.
- Tonalität testen: Kurze Sätze, verständliche Sprache, bürgernah. Kein Behördensprech.
- Qualität sichern: Wissensbasis pflegen, Monitoring fahren, Feedback-Schleifen schließen (wöchentlich QS).
Risiken & Fallstricke – und wie man sie umschifft
Einer der größten Stolpersteine beim Einsatz von KI ist ihre scheinbare Sicherheit: Generative Systeme klingen oft überzeugend – und liegen trotzdem daneben. Diese sogenannten „Halluzinationen“ können in der Verwaltung fatale Folgen haben, wenn falsche Auskünfte weiterverbreitet werden.
Das lässt sich vermeiden, indem Chatbots ihre Antworten quellenbasiert generieren, Vertrauenshinweise geben und Quellenlinks anzeigen. Die Stadt Leonberg macht das vor: Ihr Chatbot Leo greift ausschließlich auf geprüfte städtische Inhalte zu und bleibt thematisch bewusst begrenzt – ein kluger Weg, um Verlässlichkeit zu sichern.
Ebenso wichtig ist der Datenschutz. KI darf keine Blackbox sein. Klare Datenschutzhinweise, minimierte Logdaten und eine saubere Auftragsverarbeitung sind Pflicht, wenn Bürger:innen verstehen sollen, was mit ihren Anfragen passiert.
Ein weiterer Punkt ist die digitale Kluft. Nur wenn Chatbots mehrsprachig und barrierefrei gestaltet sind, erreichen sie wirklich alle Bürger:innen. Die Stadt Moers zeigt, wie das funktionieren kann – mit einem mehrsprachigen, barrierefreien System, das rund um die Uhr verfügbar ist.
Und schließlich zählt das Erwartungsmanagement: Ein Chatbot ist kein Alleskönner. Wer offen kommuniziert, was die KI kann – und was nicht, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch das Vertrauen der Nutzer:innen. Eine einfache, klare Einleitung auf der Startseite kann hier Wunder wirken.
Fazit: KI kann Service, aber Vertrauen bleibt Handarbeit.
KI im Bürgerservice ist kein Selbstzweck. Gute Lösungen sind leise, hilfreich und ehrlich: Sie beantworten Routinefragen sofort, öffnen Türen für Menschen mit Sprach- oder Mobilitätsbarrieren – und erkennen, wann Menschenübernehmen müssen. Kommunen wie Ludwigsburg, Leonberg und Moers zeigen, wie der Einstieg gelingt – pragmatisch, transparent, bürgernah.