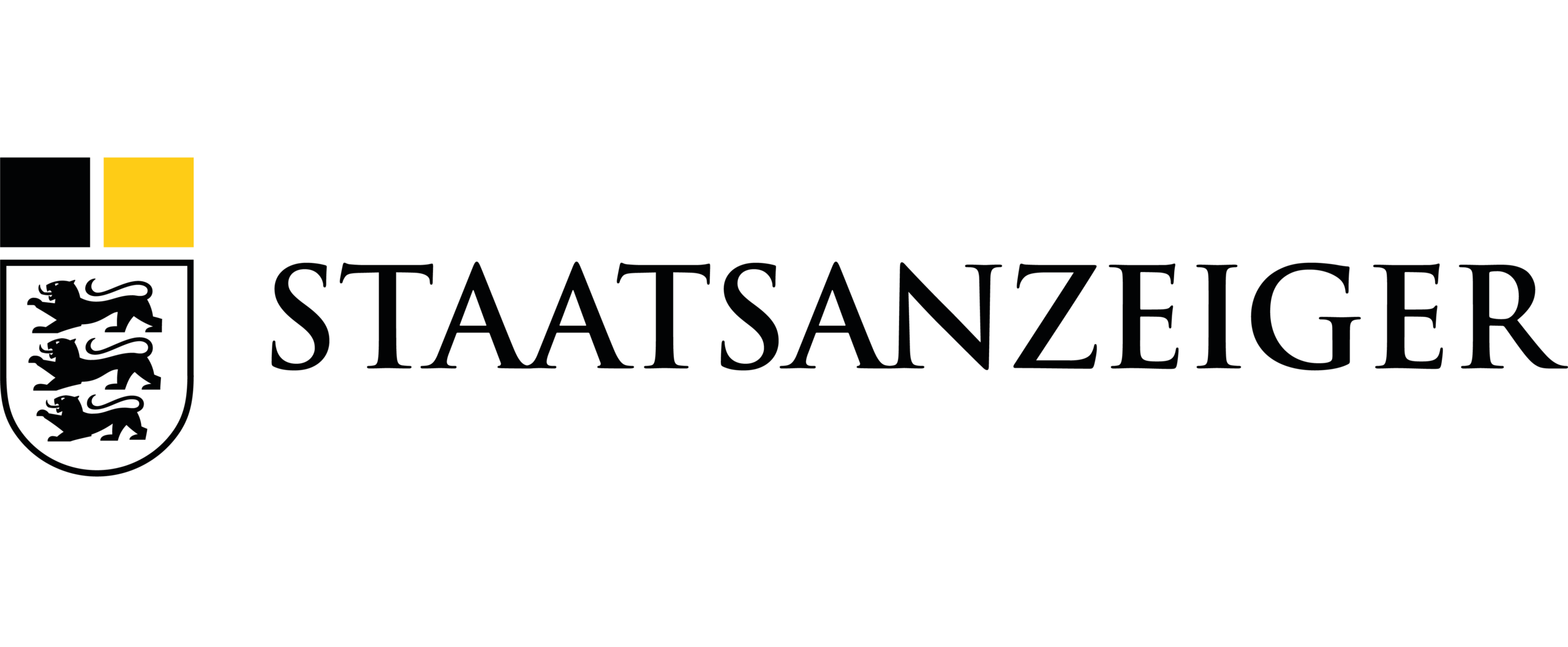Ob Schulessen, Blumenschmuck fürs Rathaus oder Baustoffe für den Bauhof – viele öffentliche Auftraggeber möchten bei der Vergabe gezielt regionale Anbieter berücksichtigen. Die Gründe sind nachvollziehbar: kürzere Lieferwege, lokale Wertschöpfung, mehr Nachhaltigkeit. Doch der Wunsch nach Regionalität stößt im Vergaberecht schnell an enge Grenzen. Was ist erlaubt und was nicht?
Der Wunsch: Regional, nachhaltig, wirtschaftsnah
In der täglichen Vergabepraxis begegnet uns das Thema Regionalität in vielen Bereichen:
- Schulverpflegung: Frische Produkte von lokalen Erzeugern.
- Lieferleistungen: Streusalz, Blumen, Pflanzen – möglichst aus dem näheren Umkreis.
- Bauleistungen: Berücksichtigung ortsansässiger Handwerksbetriebe.
- Dienstleistungen: Hausmeisterdienste, Pflege oder Winterdienst mit kurzen Anfahrtswegen.
Das Ziel: Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, lokale Wirtschaftsförderung. Doch wie lässt sich das vergaberechtskonform umsetzen?
Die Herausforderung: Herkunft ist kein Kriterium
Eine direkte Bevorzugung von regionalen Anbietern, etwa durch Punktevorteile oder Ausschlusskriterien auf Basis von Standort oder Lieferentfernung ist rechtlich nicht zulässig.
Der Grundsatz ergibt sich klar aus dem Gesetz:
- 97 Abs. 2 GWB:
„Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist ausdrücklich vorgesehen oder aus objektiven Gründen gerechtfertigt.“
Eine pauschale Bevorzugung regionaler Unternehmen aufgrund ihrer geografischen Nähe erfüllt in der Regel keinen objektiven Grund im Sinne des Gesetzes. Auch scheinbar neutrale Vorgaben wie „maximal 50 km Transportweg“ können indirekt diskriminierend wirken und gegen das Gleichbehandlungsgebot verstoßen.
Die Lösung: Nachhaltigkeit statt Herkunft
Trotzdem müssen Sie als Auftraggeber auf Regionalität nicht verzichten, Sie müssen sie nur anders denken. Der Schlüssel liegt in der Umformulierung der Kriterien: Statt den Fokus auf die Herkunft des Anbieters zu legen, sollten die ökologischen und qualitativen Aspekte im Mittelpunkt stehen.
Zulässige Zuschlagskriterien können sein:
- CO₂-Emissionen oder Energieverbrauch beim Transport
- Frischegrad oder Lieferdauer bei Lebensmitteln
- Einsatz saisonaler oder ökologisch erzeugter Produkte
- transparente Lieferketten oder soziale Standards bei Vorlieferanten
- Versorgungs- und Reaktionszeiten bei Dienstleistungen
So können regionale Anbieter punkten – nicht, weil sie in der Nähe sind, sondern weil ihre Leistungen objektiv nachhaltiger oder effizienter sind.
Fazit: Regionalität mit Augenmaß integrieren
Die Förderung regionaler Strukturen ist ein berechtigtes Anliegen. Doch im Vergabeverfahren zählt nicht die Adresse des Unternehmens, sondern die Qualität und Nachhaltigkeit des Angebots. Wer seine Kriterien sauber formuliert, kann Regionalität rechtssicher berücksichtigen und vermeidet rechtliche Risiken.
Sie möchten mehr erfahren?
Wir unterstützen Sie als öffentlichen Auftraggeber dabei, Nachhaltigkeits- und Regionalitätsziele rechtskonform in Ihre Vergabeverfahren zu integrieren, von der strategischen Planung bis zur konkreten Formulierung der Zuschlagskriterien.